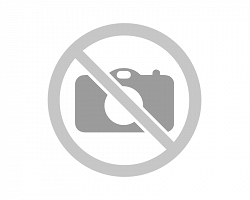Brennero: eine Fantasie über (falschen) Südtiroleren Weisen
30. September 2024
Fragt die schöne Dame die junge Frau an der Türschwelle ihres Hauses: “Non sei stata tu a rubare il quadro, giusto? … sei stata tu?” “no…no…è stato Martin” antwortet das Mädchen, “E’ violento con te?” fragt die Dame erneut. Von drinnen ertönt eine männliche Stimme: „Mathi!“ „Ich rauche, komme!“, antwortet das Mädchen. Die Frau fährt dann fort: “Mathilde, io posso proteggerti…”. Der Dialog, der bis auf den deutschen Einsatz der männlichen Stimme auf Italienisch ist, findet in der Nähe der sehr resignierten Wohnung der jungen Frau (Mathilde Comi, gespielt von Sinead Thornhill) statt.
Es ist ein Höhepunkt der zweiten Folge der Fernsehserie Brennero, eine Rai 1 Produktion. Bei der besagten Dame handelt es sich um die Bozner Hauptkommissarin Eva Kofler. Nicht wenige wird diese Figur mit einer anderen berühmten Eva in Verbindung gebracht haben, die zufällig mit der besagten Dame den Vornamen, einen Großteil des Nachnamens (auch mit ihr verwandt), das hübsche Gesicht, aber sicher nicht die Frisur teilt. Schon die junge Mathilde, eine Malerin, die sich als Evas Tochter entpuppte, hatte heftige Kritik von ihrem Vater - Gerhard Kofler - einem deutschen Muttersprachler und ehemaligen Bozner Oberstaatsanwalt - einstecken müssen, weil ihre Malerei “un accostamento a Klimt completamente inappropriato” sei. Derselbe Protagonist, der in seiner schlanken und strengen Gestalt einer anderen historischen Figur der Südtiroler Politik ähnelt, wird seine zweisprachige Tochter auf Deutsch sehr barsch ansprechen, aber auf Italienisch die süße, verständnisvolle, liebevolle Seite des Vaters zeigen, wenn er seine Sorge um sie mit Einfühlungsvermögen und ohne Besitzdenken zum Ausdruck bringt: “Cosa è successo? Stai bene?”.
Wenn 2+2 vier ergibt, der Zeitpunkt der Verwendung der beiden Sprachen und ihre Kontextualisierung - angeblich gewalttätiger Verlobter und übermächtiger Vater auf Deutsch, liebevolle Freundlichkeit, Schutzangebot und väterliche Sanftmut auf Italienisch - wäre es nicht unangebracht zu vermuten, dass das Drehbuch der Serie den Millionen von Italienern, die sie verfolgt haben, nun ein tendenziöses Bild der italienisch-deutschen Südtiroler Dichotomie vermittelt hat. Schon allein diese beiden filmischen „Kamee“ können sich tief in das Gewissen eingraben oder zumindest den Betrachter in einen Zustand der Voreingenommenheit und Erwartung versetzen, einen „confirmation bias“, dessen mögliche Leugnung in einem Missverständnis und nicht in seiner Entmystifizierung begründet wäre.
Unabhängig von der Entwicklung der Handlung und der erklärten Absicht des Drehbuchs - die Integration und das Zusammenleben zwischen „Deutschen“ und „Italienern“ zu fördern - kann man, um eine Parallele zu einer bekannten Redewendung zu ziehen - nicht verlangen, dass man nicht an grüne Elefanten denkt, ohne an sie zu denken.
Seien wir ehrlich: wie oft haben wir schon einen Roman gelesen, der in einem uns unbekannten Land spielt (abgesehen von ein paar Klischees), aber wir waren fasziniert von seiner Vielfalt, seinen Exotismen und auch davon, wie diese mit der Handlung verwoben waren? Haben wir Kiplings Kim und den damit verwandten Roman The far Pavillons von M. M. Kaye gelesen (beide wurden bekanntlich verfilmt) und dann die absolute Genauigkeit und Unvoreingenommenheit der Beschreibung Indiens dokumentiert, das uns durch exotische Klischees bekannt ist, die für das Vergnügen an der Erzählung ausreichen? Wir wollen einen guten Plot, keinen Dokumentarfilm, allerdings auf die Gefahr hin, dass der Plot selbst Elemente enthält, die, wie Chateaubriand sagen würde, „plus royalistique que le roy“ sind.
Eine Konstellation musikalischer Weisen (volkstümliche Themen und Melodien) in eine in sich geschlossene, kohärente Einheit umzuwandeln, war die Spezialität des Komponisten Franz Liszt, und zwar nicht nur für seine bekannten Ungarischen Rhapsodien, sondern auch für ein umwerfendes Klavierstück, die „Fantasie über spanische Weisen“, die in musikalischer Hinsicht das ist, was später aus dem exotischen Abenteuerfilm werden sollte, und zwar mit großer Vorwegnahme. Der Hörer dieses beeindruckenden Stücks hat den Eindruck, dass die Themen (Weisen) zusammengehören sollen, was aber nicht der Fall ist.
Einige der bekannten Südtiroler „Weisen“ - mit einigen Annäherungen und Klischees - durchdringen den Bildschirm von den ersten Bildern an: die Rittner-Seilbahn, Bierkrüge (1 Liter. ), die - und das ist eine Übertreibung - von Kellnerinnen in deutscher und italienischer Sprache den jeweiligen Fangruppen serviert werden, die in zwei verschiedenen Sprachen den Sieg derselben Eishockeymannschaft feiern: Bolzano für die einen und Bozen für die anderen, die sich auf der Piazza della Vittoria treffen (nicht auf dem Waltherplatz, die den Nichttirolerinnen und Nichttiroler zumindest für ihren Weihnachtsmarkt bekannt ist)?
Ein Krimi im Stile des nordeuropäischen „noir“ wie „Brennero“, der in einem Land spielt, in dem alte Probleme wieder aufleben, auch - oder vielleicht vor allem - wegen des nicht dokumentierten Wissens über die Gegenwart und die jüngste Vergangenheit sowie wegen des Nachgebens in Alltäglichem, das für en passant und oberflächliche Urteile nützlich ist, kann jedoch leicht in das gefährliche Gebiet der unausgesprochenen Propaganda geraten.
Die sprachliche Vielfalt, die in Südtirol vor allem in der deutsch-italienischen Dichotomie begründet ist, ist schwieriger darzustellen als die charakterliche Vielfalt, die sich dagegen leichter zuordnen lässt, und alte Stereotypen. Da ist zum Beispiel die deutsche Ernsthaftigkeit und Strenge im Gegensatz zur italienischen Elastizität, Kreativität und Freundlichkeit. Im Büro von PM Eva Kofler arbeiten eine junge italienische Mutter, Cecilia Martini (gespielt von einer Brünetten mit süßen Gesichtszügen, die sogar ihr Baby im Büro stillt) und eine blonde deutsche Polizistin, Lena Pichler, gespielt von der schönen Katja Lechthaler, die hier entblößt und mit harten, nordischen Gesichtszügen gezeigt wird, fast eine Schwester von Tilda Swinton in The Room Next Door (ein weiterer Krimi, der dieses Jahr erschienen ist). Lechners unfassbare Schönheit erinnert mich an die von Carla Gravina, die in Il Segno del Comando, dem erfolgreichsten von der RAI produzierten Serienkrimi, unnachahmlich war. Auch dieser Serie verfügte über eine unübertroffene „Noir“-Atmosphäre, das Helldunkel des nächtlichen Roms, das Bozen mit seiner kahlen, faschistischen Architektur nicht bieten kann.
Obwohl wir endlich weit von jener filmischen Aussaat des italienischen Realismus entfernt sind, die auf - realen oder fiktiven - Episoden des Zweiten Weltkriegs beharrte („Roma città aperta“ von Rossellini), die in Italien antideutsche Stereotypen schürte, die heute irrelevant und keineswegs überholt sind - vor allem in Bezug auf die schmerzhafte Geschichte Südtirols - können wir nicht mit Sicherheit sagen, wie viele Schatten jener Zeit und der nachfolgenden Stereotypen zumindest teilweise noch im italienischen kollektiven Unbewussten präsent sind. Die Bewunderung, die Südtirol in Italien genießt, ist vielleicht immer noch zu sehr touristisch geprägt, als dass sie aus dem Alltag und der hohen Lebensqualität stammen würde. Es wäre in der Tat interessant, die sprachliche Vielfalt als solche darzustellen und sich auf die Hypothese von Sapir und Whorf über den sprachlichen Determinismus zu stützen, wie die Sprache, die man spricht, das Denken und Handeln der Menschen beeinflusst. Die Bergkulissen, die in vielen Szenen auftauchen, können beim Südtiroler leicht ein Gefühl der „Waldeinsamkeit“ (ein nicht übersetzbarer Begriff) hervorrufen, das sich auch aus einem religiösen Glauben und einem Gefühl der Zugehörigkeit zur Natur zusammensetzt, die nicht nur „ein schöner Ort“, sondern ein Ort der Seele ist. Andernfalls sind die italienischen Betrachter enttäuscht, wenn sie diese schönen Urlaubsorte sehen, die nun fast unbewohnt und traurig sind, was dem „Noir“-Stil der nordeuropäischen Schrift geschuldet ist.
Wer nicht an den sprachlichen Determinismus glaubt, kann nicht umhin, sich davon beeindrucken zu lassen, wie raffiniert Andrea Camilleri ihn in seinem Krimi La mossa del cavallo (Der Zug des Springers) inszeniert. Hier ist der Zug - in Anlehnung an das Schachspiel - die semantische Epiphanie, mit der die Figur, die - ähnlich wie die Figuren in Brennero - mit der Aufklärung eines Verbrechens beschäftigt ist, die richtige Merkfähigkeit für ein Detail des Tatortes hat, ermöglicht durch einen Sprung von einer Sprache in die andere (wie der Springer), und als corpus delicti bedeutet „cuscino“ im Italienischen „Kissen“, im Sizilianischen aber „Cousin“.
Ein möglicher semantischer Sprung misslingt in Brennero Gerhard Kofler jedoch, als er sich in Begleitung seiner Tochter einer Art MMSE-Test zur Anamnese einer vermuteten Alzheimer-Krankheit unterzieht. Der Test wird auf Italienisch durchgeführt, nicht in seiner Muttersprache; Kofler merkt sich die italienischen Namen von drei Blumen, erinnert sich aber nicht mehr an sie, nachdem die Prüferin ihn mit der emotionalen Erinnerung - auf Italienisch - an die Geburt seiner Tochter und den Tod seiner Frau abgelenkt hat. Der „Sprung“ von einer Sprache in die andere erfolgt jedoch mit einer verbalen Schimpftirade (die extremste der gesamten Serie) auf Deutsch gegen die Tochter, weil er die Prüfung nicht bestanden hat.
Die Serie Brennero, die sich durch eine typisch italienische Qualität der Fotografie und eine großartige Originalmusik (von Giuliano Taviani, Carmelo Travia) auszeichnet, zeigt zu Beginn ein typisches Beispiel für die Struktur der antiken und modernen epischen Erzählung, wie sie von Joseph Campbell geschickt veranschaulicht wurde, d. h. sie beginnt immer mit dem Auftauchen eines Objekts und der anschließenden Anerkennung der Heldenfigur, bevor diese ihre epische Reise vollendet. Hier ist es das Symbol des Herzen Jesus, das auf die Leiche des Opfers des „Mostro di Bolzano“ gelegt wird, das leider nur mit der Feuernacht assoziiert wird, aber nicht in seiner authentischsten und aktuellsten Bedeutung dargestellt wird. Dies erinnert auch an ein anderes Gimmick in zeitgenössischen Krimis, Dan Browns (die auch in eine erfolgreiche Verfilmung mündete), Angels and Demons und das (allerdings antireligiöse) Symbol der „Illuminaten“ auf den Leichen ihrer Opfer. Auch hier die Rache einer Gruppe an einer anderen, auch hier religiösen Symbolik.
Südtirol ist nicht ein „Grenzgebiet“. Bozen ist nicht Straßburg, wo der Sprung zwischen den beiden Sprachen und Kulturen (und Küchen!) kürzer ist als ein Zug des Springes. Bozen ist eine Tiroler Stadt, die seit etwa hundert Jahren zum italienischen Staat gehört, deren mehrheitlich italienische Präsenz das Erbe der staatlichen Institutionen ist, deren Region aber mehrheitlich deutschsprachig und deutsch-kulturell geprägt ist, mit einer tirolerischen Konnotation, die sich in der hundertjährigen italienischen Geschichte erhalten hat. In diesem Seriendrama wird Südtirol stattdessen als ein Stück Italien mit Resten von deutschsprachigem Konservatismus auf dem Weg zur Integration zwischen den beiden großen Sprachgruppen dargestellt. Dies ist nicht der Fall. Der Durchschnittsitaliener hat Respekt vor dem, was die Tiroler Lebensart über seine deutsche kulturelle Herkunft aussagt. Manchmal ist dieser Respekt verklemmt und manchmal wird er durch unterschiedliche Verhaltensweisen getrübt. Dieser Respekt bildet sich zuerst im Kopf, wenn man Ordnung und Ruhe für einen schönen Urlaub in der Tiroler Natur vorzieht, und dann im Herzen, wenn man dieses religiöse Gefühl der Vertrautheit und des Kontakts mit dem eigenen Land entdeckt.
Ich würde niemals einen Klavierstimmer bezahlen, um das Klavier vor einer Aufnahme zu verstimmen. Ich habe den Eindruck, dass dies bei Brenner geschehen ist, mit einer Zuweisung von lokalen Mitteln von nicht weniger als einer halben Million Euro. Obwohl weit entfernt von dem faschistischen Diktat „siamo in Italia, si parla solo italiano“, verraten einige Fauxpas in den Dialogen des Drehbuchs, was in Artikel 19 des Autonomiestatuts rechtlich verankert ist, wenn Eva ihren Vater bittet, mit ihrem Mitarbeiter Italienisch zu sprechen, weil sie beide 'Beamte' sind. Zu Recht beschweren sich daher Senatorin Julia Unterberger und die ehemalige Landtagsabgeordnete Eva Klotz: Eva Koflers Äußerung „Siamo pubblici ufficiali, papà, dovresti parlare italiano“ ist rechtlich nicht korrekt.
Carlo Grante

Am 16. Mai 2025 fand zum bereits 16. Mal der „Tag der Bäuerinnen und Bauern“ in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff statt. Rund 150 Betreiberinnen und Betreiber der „Roter Hahn“-Betriebe folgten der Einladung und nutzten den Tag, um die Gartenwelten und das Touriseum zu erkunden. Die seit vielen Jahren bestehende Partnerschaft zwischen ...

Bittgang um geistliche Berufungen „Zur schmerzhaften Muttergottes“ in Riffian Am Samstag, den 10. Mai 2025 waren die Gläubigen der Seelsorge-Einheit Meran zum Bittgang nach Riffian eingeladen. Am 4. Sonntag der Osterzeit (heuer am 11. Mai) beging die Weltkirche den 62. Weltgebetstag um geistliche Berufungen, der 1964 von Papst Paul VI. während des Zweiten ...

10.000 € Spende für Jungle und Jugenddienst Der Rotary Club Meran veranstaltete kürzlich erstmalig eine Benefiz-Weinversteigerung im Schloss Pienzenau, bei der insgesamt 10.000 € an Spenden gesammelt werden konnten. Diese Veranstaltung bot eine einzigartige Gelegenheit, eine exklusive Weinverkostung ganz im Zeichen des Mottos „Rotary and Friends“zu ...

Mit Ende März hat die EO Tierheim Naturns ihren provisorischen Standort in Ulten geschlossen – und damit ein intensives Kapitel ihrer Geschichte, aber auch des ersten Tierheims in Südtirol, beendet. Bei einer Pressekonferenz in Meran stellte Vereinspräsidentin Silvia Piaia die zukünftige Ausrichtung des Vereins vor, der sich nach sieben Jahren voller Höhen und ...