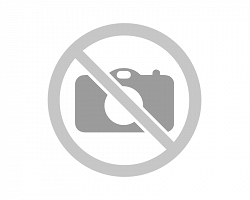Gastkommentar von Carlo Grante
Die 'Walsche' Side Story
20. January 2025
Die 'Walsche' Side Story
Leonard Bernsteins Meisterwerk West Side Story zeigt im New York der 1950er Jahre jene ethnischen Konflikte (zwischen 'Puertoricanern' und 'Yankees', beide jedoch US-Bürger), die durch die jüngste Episode - die Verprügelung eines jungen Mannes in Brixen und das gegen ihn gerichtete Schimpfwort - gefährlich aktuell erscheinen. Mit Unterschieden. In Bernsteins Meisterwerk (das an Shakespeares bekanntes Meisterwerk Romeo und Julia erinnert) erblüht innerhalb der Unterschiede und des Hasses der ethnischen Fraktionen auch ein Meisterwerk des Liebesliedes: „Maria“. Ein weiterer grundlegender Unterschied betrifft die existenzielle Typologie der beiden New Yorker Gruppen. Die eine von ihnen (puertoricanischer Abstammung) repräsentiert nicht eine Region mit spezifischer Sprache und Kultur, die einem Staat angegliedert ist, der in beiderlei Hinsicht anders ist (mit vergangenen kulturellen Verbrechen, die manche noch immer nicht verdauen können), sondern beide sind frei „amerikanisch“. Ein weiterer Unterschied ist die Art und Weise, wie sich die Schlägerei von Brixen abgespielt hat: eine ungleiche und feige Konfrontation durch eine Gruppe mit einer numerischen Mehrheit, die jede Hypothese einer Eskalation einer „Schlägerei“ oder einer gewalttätigen Auseinandersetzung zunichte macht. Es ist fair und ehrlich, im Sinne einer strengen Berichterstattung zu versuchen, zu verstehen, ob der ethnische Unterschied (ein unzulässig verwendeter Begriff) der Auslöser für den Vorfall war, d.h. eine „Walsche Sau“ zu sein, oder unabhängige Gründe, die dem hasserfüllten Ausdruck folgten. Während eines Fußballspiels kann es zu mehr als einem Gewaltakt zwischen Gruppen kommen. Ich kann mir vorstellen, was passieren würde, wenn ich in einer „Sportsbar“ in Neapel ein Juventus-Trikot tragen würde: Man würde mich als „dreckigen Juventino“ bezeichnen (und dann gemeinsam einen neapolitanischen Kaffee trinken), ohne dass dies ein Auslöser für Gewalt wäre. Aber zu einem Zeitpunkt in der Geschichte, an dem große Fortschritte in Bezug auf die ethnisch-kulturelle Inklusion und die Achtung der Geschlechter gemacht wurden, was dazu geführt hat, dass der Verwendung von verfänglichen und ausgrenzenden Ausdrücken (sogar dem korrekten männlichen oder weiblichen Artikel, der die eine Kategorie nicht von der anderen trennt) mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, wenn man kollektiv und nicht sektoral denken will, wurden in diesem Teil der Welt, der für seine zivilisierte Lebensweise bewundert wird, stattdessen keine Fortschritte bei Ausdrücken gemacht, die eine ethnisch abwertende Konnotation haben. Als ich vor einigen Jahren mein Programm für einen Klavierabend in den Vereinigten Staaten vorstellte, wies mich ein amerikanischer Kollege darauf hin, dass eines der von mir ausgewählten Stücke, Ferruccio Busonis Indianisches Tagebuch, nicht den ursprünglichen Untertitel Vier Klavierstudien über Motive der Rothäute Amerikas tragen dürfe, da der Begriff Rothaut nicht nur politisch unkorrekt, sondern auch verborten sei, wenn er öffentlich verwendet werde. Vor einiger Zeit ist mir bei einem Vortrag an einer amerikanischen Universität ein Fauxpas unterlaufen, als ich in Bezug auf die Einflüsse auf Claude Debussys Musik den Begriff „orientalisch“ statt „asiatisch“ verwendete. Nun, da es jedem von uns im Privaten freisteht, die Welt und ihre menschlichen Bestandteile mit den Begriffen zu beschreiben, die er oder sie bevorzugt, aber die Pflicht hat, keine beleidigenden Ausdrücke gegen Menschen zu verwenden, die „anders“ sind, frage ich mich allerdings, ob es hier in Zukunft angebracht ist, den „ethnischen“ Konflikt zumindest in der Kontrolle eines Lexikons zu verwässern, das wir als traurig historisch betrachten können. Bei einer kürzlich stattgefundenen Gedenkveranstaltung der Meraner Akademie (deren stolzer Fellow ich bin) hat mein (seit einigen Jahren bin ich hier ansässiger) Landeshauptmann die „ethnische Frage“ mit dem Hinweis auf die Wichtigkeit, aus sich selbst herauszutreten und auf den anderen zuzugehen, hervorgehoben. Diese Worte, denen ich voll und ganz zustimme, ließen mich sofort an den recht weit gefassten Begriff des „Andersseins“ denken, der für die Gewalt in der Geschichte verantwortlich ist, wenn Gruppen verschiedener Religionen oder Ethnien gegeneinander ausgespielt werden. Für diejenigen, die wir als „anders“ betrachten, empfinden wir weniger Empathie, wir können ihr Leid nicht vollständig nachempfinden. Ich stimme weniger mit der Ansicht des Landeshauptmanns überein, dass der Melting Pot 'trivial' ist. In der Tat kann ich aus meiner amerikanischen Erfahrung heraus behaupten, dass der Begriff Melting Pot übertrieben ist, vor allem in seiner Übersetzung: Er soll einen Zustand beschreiben, in dem die Menschen nicht wie in einem alchemistischen Schmelztiegel vermischt werden, sondern in dem die Unterschiede für eine breite Sicht auf die menschlichen Facetten genutzt werden, die den Einzelnen in eine privilegierte Position bringt. Die Zugehörigkeit zu einer Sprache oder ethnischen Gruppe oder die historische Herkunft der Familie spielt eine geringere Rolle als die Zugehörigkeit zu einem kollektiven Wertemuster. Wenn ich öffentlich von einer Person, die sich politisch für die Verteidigung der Identität und der Selbstbestimmung ihres Landes einsetzt (wer meine jüngsten Artikel gelesen hat, kann meine Unterstützung für die Südtiroler Sache bestätigen), höre, dass sie niemals einen Partner haben könnte, der nicht aus ihrem Heimatland stammt, ist es für mich spontan, eine rein arithmetische Gleichung der Möglichkeiten aufzustellen, die diese Person aufgibt. Ziehen wir die Zahl der Einwohner des Globus von der ihres Landes ab: gibt es unter den verbleibenden 99,996 % der Menschheit wirklich niemanden, der Wahlverwandtschaften aufweisen kann? Diese Wahl oder Nicht-Wahl lässt Bernsteins Maria und Shakespeares Julia als zwei Verräter ihres ethnischen Stolzes erscheinen und nicht als Beispiele für Freiheit, Selbstbestimmung, Mut und... wahre Liebe. In ähnlicher Weise frage ich mich, wenn ich die Forderung nach einer Nation einer „Farbe“ höre, ob eine solche provinzielle Mentalität, die zwar nicht direkt Strafexpeditionen auslöst, die zu ethnischer Gewalt führen, nicht den Keim für gefährliche zukünftige Entwicklungen in sich trägt. Zur korrigierenden Verwendung des Nominalismus: Wenn jemand in der Politik darauf besteht, unzivilisiertes und gewalttätiges Verhalten von Ausländern zu thematisieren (und sich zu Recht darüber zu entrüsten), nicht aber die Verurteilung desselben Verhaltens von Einheimischen, sollten wir dann nicht an dieser Stelle den Begriff „Ausländergewalt“ abschaffen oder, um ehrlicher zu sein, den der „Einheimischengewalt“ einführen? Ich schlage die erste Option als die beste Lösung vor. Misstrauen erwecken bei mir auch diejenigen in der Politik, die gegen Gewalttaten ankämpfen, aber die ungewöhnlich brutale Gewalttat in Brixen ignorieren und die Aufmerksamkeit auf eine viel weniger schwerwiegende Gewalttat in Meran lenken, die von einem „Ausländer“ verursacht wurde. Ich möchte sagen, dass der Vorfall mit der Schlägerei und dem daraus resultierenden oder kausalen Beinamen nicht instrumentalisiert werden oder den aktuellen Zustand der Beziehungen zwischen den beiden Hauptsprachgruppen in Südtirol darstellen sollte, das immer noch eines der zivilisiertesten Länder der Welt ist. Aber es sollte wichtige Fragen über die Zukunft Südtirols und darüber, wie wir sie wollen, aufwerfen. Mögen die Worte von Samuel P. Huntington in seinem bekannten Buch The Clash of Civilisations (1993) nicht prophetisch sein:
„Die Weltpolitik tritt in eine neue Phase ein, und Intellektuelle haben nicht gezögert, Visionen darüber zu verbreiten, was das sein wird - das Ende der Geschichte, die Rückkehr der traditionellen Rivalitäten zwischen den Nationalstaaten und der Niedergang des Nationalstaates durch die widersprüchlichen Anziehungskräfte von Stammesdenken und Globalismus, um nur einige zu nennen.“
Carlo Grante

Am 16. Mai 2025 fand zum bereits 16. Mal der „Tag der Bäuerinnen und Bauern“ in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff statt. Rund 150 Betreiberinnen und Betreiber der „Roter Hahn“-Betriebe folgten der Einladung und nutzten den Tag, um die Gartenwelten und das Touriseum zu erkunden. Die seit vielen Jahren bestehende Partnerschaft zwischen ...

Bittgang um geistliche Berufungen „Zur schmerzhaften Muttergottes“ in Riffian Am Samstag, den 10. Mai 2025 waren die Gläubigen der Seelsorge-Einheit Meran zum Bittgang nach Riffian eingeladen. Am 4. Sonntag der Osterzeit (heuer am 11. Mai) beging die Weltkirche den 62. Weltgebetstag um geistliche Berufungen, der 1964 von Papst Paul VI. während des Zweiten ...

10.000 € Spende für Jungle und Jugenddienst Der Rotary Club Meran veranstaltete kürzlich erstmalig eine Benefiz-Weinversteigerung im Schloss Pienzenau, bei der insgesamt 10.000 € an Spenden gesammelt werden konnten. Diese Veranstaltung bot eine einzigartige Gelegenheit, eine exklusive Weinverkostung ganz im Zeichen des Mottos „Rotary and Friends“zu ...

Mit Ende März hat die EO Tierheim Naturns ihren provisorischen Standort in Ulten geschlossen – und damit ein intensives Kapitel ihrer Geschichte, aber auch des ersten Tierheims in Südtirol, beendet. Bei einer Pressekonferenz in Meran stellte Vereinspräsidentin Silvia Piaia die zukünftige Ausrichtung des Vereins vor, der sich nach sieben Jahren voller Höhen und ...